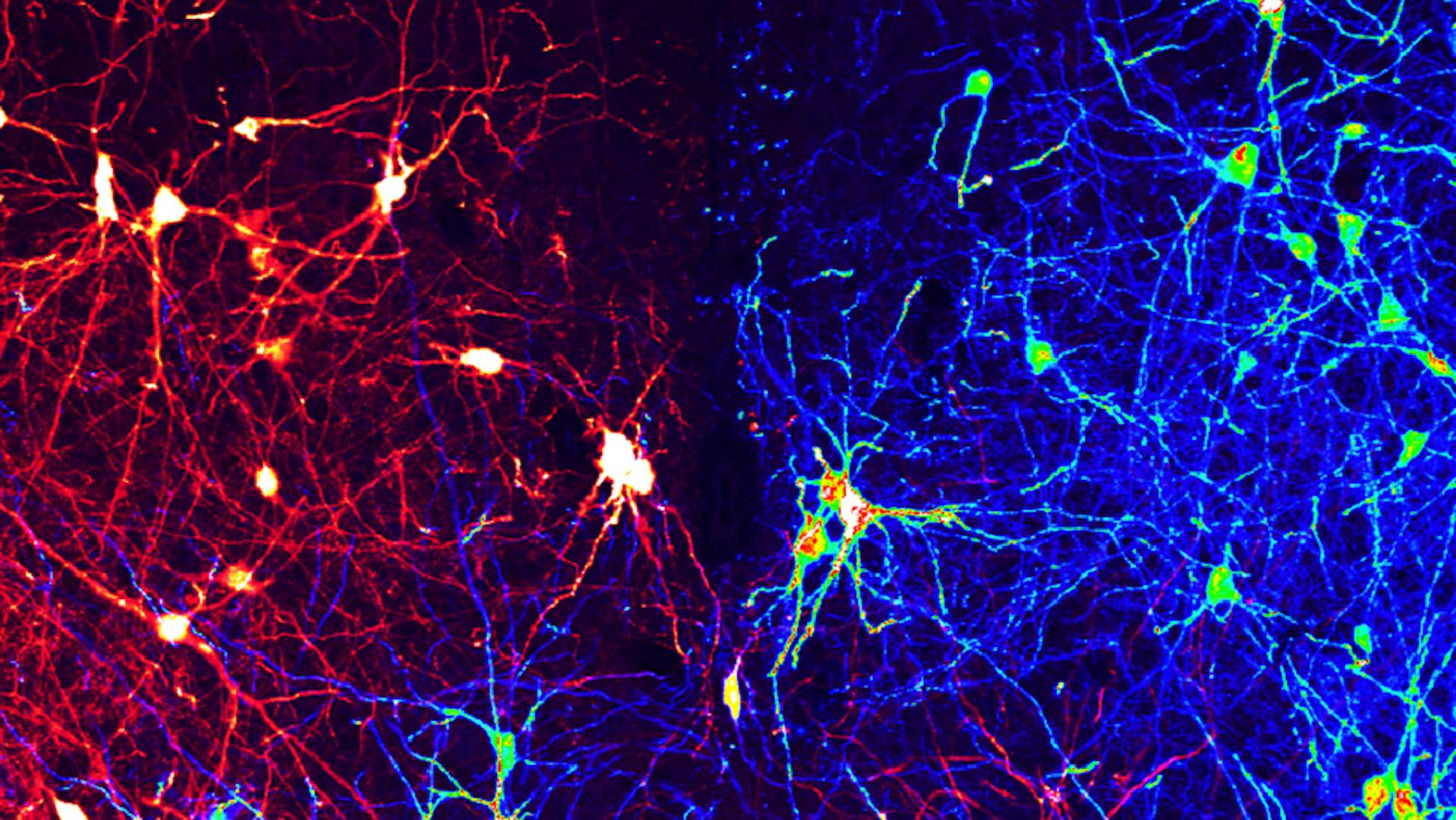Präzision und Ausdauer
(Dieser Artikel wurde ursprünglich im Campus Magazin 2017 publiziert.)
Symetis wurde 2001 als Spin-off der Universität Zürich gegründet. Das Ziel des Start-ups war, erstmals Herzklappen aus patienteneigenen Zellen zu entwickeln. Als das Projekt scheiterte, verlagerte Symetis den Fokus auf die Entwicklung eines Herzklappen-Ersatzsystems, die eine Alternative zur offenen Herzoperation schaffen sollte. Obwohl auch der zweite Versuch fast fehlschlug, wurde Symetis zu einem der erfolgreichsten Schweizer Medizinaltechnikanbieter, vor allem dank der Ausdauer seiner Gründer und Investoren, zu denen auch der Novartis Venture Fund zählt. Die Präzision und der innovative Charakter der Symetis-Produkte treiben heute das Wachstum des Unternehmens voran, das seit 2017 Teil von Boston Scientific ist.
Text von Goran Mijuk und Michael Mildner





Jacques Essinger
 Inhalt
Inhalt Langer Weg
Langer Weg Den Ablauf auf den Kopf gestellt
Den Ablauf auf den Kopf gestellt Anwendungsfreundliche Lösung
Anwendungsfreundliche Lösung Langer Atem
Langer AtemIm Jahr 2007 waren Jacques Essinger und Stéphane Delaloye kurz davor, das Handtuch zu werfen.
Monatelang hatten die beiden an einem medizinischen Ansatz gearbeitet, der es Chirurgen erleichtern sollte, künstliche Herzklappen einzusetzen. Aber der Stent, an dem die Herzklappe befestigt war, verrutschte bei jedem Test aus seiner Position. Dieses Problem verschlang fast alles Geld und alle Hoffnung ihres Start-ups Symetis.
Im Untergeschoss des Waadtländer Universitätsspitals CHUV in Lausanne hatten sie zahlreiche Versuche durchgeführt. Obwohl die beiden viele Verbesserungen am komplexen Metall-Stent vornahmen und über 30 verschiedene Varianten ausprobierten, kamen sie zu keiner Lösung.
«Das war der schwärzeste Moment meiner Karriere. Uns blieb nur noch Geld für drei Monate, aber wir konnten dieses technische Problem nicht lösen», erinnert sich der Physiker und Biomechanikexperte Jacques Essinger, der Symetis seit 2004 als CEO leitet.
Sein Kollege Stéphane Delaloye, der 2006 zum Unternehmen stiess, war genauso entmutigt. «Es sah alles danach aus, als hätten wir keine Chance mehr. Vor unserer vermeintlich letzten Teamsitzung war die Stimmung düster.»
Vorzeitiges Scheitern einer Idee
Essinger ging bereits 2005 durch eine ähnliche Krisenphase. Symetis war gerade seit vier Jahren im Geschäft und scheiterte am Versuch, Herzklappen aus patienteneigenem Zellgewebe zu entwickeln.
Obwohl die Methode vielversprechend schien und in einem Fall in den USA sogar erfolgreich angewendet wurde, konnten die Symetis-Forscher die Ergebnisse der ersten Studie aus Boston nicht reproduzieren.
Schliesslich beschloss der Symetis-Verwaltungsrat, in dem auch Reinhard Ambros vom Novartis Venture Fund vertreten war, das Projekt einzustellen. Mit den verbleibenden Mitteln wollte man stattdessen eine künstliche Herzklappe entwickeln, die an einem Stent im Herzen des Patienten befestigt werden sollte. Einen Prototypen des Stents – ein x-förmiges Gittergerüst, das leicht zusammenzufalten war und minimalinvasive Eingriffe über einen Katheter erlaubte – hatte der Herzchirurg Prof. Ludwig Karl von Segesser in Lausanne bereits angedacht.


Stéphane Delaloye
Bis zur Entwicklung solcher Katheter musste man zum Ersatz von Herzklappen normalerweise eine Operation am offenen Herzen durchführen - ein äusserst belastender Eingriff, vor allem für ältere Patienten.
Angesichts dieser Situation suchten einige Ärzte nach neuen Methoden, um die Ersatzklappen über einen Katheter ins Herz einzuführen. Ein solcher Eingriff erfordert nur einen kleinen Einschnitt in der Leiste oder zwischen den Rippen, anstatt dass man Brustbein und Rippen des Patienten durchdringen und ihn an eine Herz-Lungen-Maschine anschliessen muss.
Die erste erfolgreiche Transkatheteroperation wurde 2002 in Frankreich durchgeführt. Sie entfachte weltweites Interesse an der Entwicklung neuer Lösungen, wie beispielsweise des Diabolo-Stents von Prof. von Segesser.
Neustart
Vor diesem Hintergrund wurde Jacques Essinger mit dem Turnaround von Symetis beauftragt. Er war der einzige verbliebene Mitarbeiter von Symetis und verlegte den Sitz des Unternehmens von Zürich in die Westschweiz, um einfacher mit von Segesser zusammenarbeiten zu können. Über Headhunter stiess er dann auf den erfahrenen Medizintechnik-Ingenieur Stéphane Delaloye. In der Bar des Zürcher Hotels Schweizerhof bot Essinger ihm an, bei Symetis einzusteigen.
«Ich sagte Jacques, dass ich einen Jobwechsel erst mit meiner Frau besprechen müsse», erinnert sich Stéphane Delaloye, damals Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Schweizer Medizintechnologie-Unternehmens Biotronik in Bülach. «Dass ich ein gut gehendes Unternehmen verlassen würde, war nicht das einzige Hindernis. Ein weiteres grosses Problem war, dass ich für den Job nach Lausanne ziehen musste, während meine Familie in Zürich blieb.»
Delaloye, der schon für branchenführende Unternehmen wie Schneider gearbeitet hatte, zögerte zunächst noch mit einem Wechsel zu Symetis. Jacques Essinger setzte aber alles daran, den erfahrenen Ingenieur für Symetis zu gewinnen. Er bot ihm an, auf Teilzeitbasis nach Lausanne zu kommen und die restliche Zeit von zu Hause in Zürich aus zu arbeiten, um mehr bei seiner Familie zu sein.
«Ich wusste, dass ich Stéphane brauchte. Er ist ein vorzüglicher Ingenieur und kann sich durchbeissen, wenn es schwierig wird», erläutert Essinger. «Er ist sehr bescheiden und zugleich von beruflicher Neugier angetrieben und strebt stets nach Perfektion.»




Es wurden mehr als 30 Varianten entwickelt, bis Symetis die erste Patientenstudie starten konnte.
Kurz nach seinem Wechsel zu Symetis begann Delaloye mit der Entwicklung eines Stents, der auf dem Prototyp von Prof. von Segesser basierte. Er sollte einfach zusammenzufalten und in einen Katheter einzuführen sein, um sich anschliessend im Herz des Patienten automatisch zu entfalten.
Aber obwohl Delaloye es schaffte, einen Stent zu entwickeln, der im aufgefalteten Zustand über einen Radius von über 20 Millimetern verfügte und bis auf wenige Millimeter komprimierbar war, schien es unmöglich, das Metallgitter im Herzen zu fixieren.
«Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen war uns klar, dass der Verwaltungsrat das Projekt einstellen würde, wenn wir nicht bald überzeugende Ergebnisse lieferten», erinnert sich Essinger. «Wir standen mit dem Rücken zur Wand. So beschlossen wir, in einem gemeinsamen Brainstorming einen allerletzten Versuch zu machen.»
Bei der vermeintlich letzten Sitzung betrachteten sie die Konstruktion des Stents nochmals von allen Seiten und fragten sich, warum er nicht hielt. Da sie keinen Fehler am Stent entdeckten, kamen sie schliesslich auf den Gedanken, den Ablauf der Stententfaltung einfach umzudrehen. Bei allen früheren Tests wurden nach der Implantation immer zuerst der unterer und danach der obere Teil des Stents geöffnet. Jetzt versuchten sie es andersherum. Und der Stent hielt.
Test an Patienten
Dieser Durchbruch sicherte Symetis auch die Rückendeckung des Verwaltungsrates. Es wurden weitere Mittel beschafft, um die Arbeit fortzusetzen und das Produkt für Tests an Patienten vorzubereiten.
«Es war eine ziemlich knappe Sache», erinnert sich Reinhard Ambros, der seit 2005 dem Novartis Venture Fund vorsteht und Symetis seither in mehreren Investitionsrunden begleitet hat. «Wir waren mit der ursprünglichen Investitionssumme sparsam umgegangen und hatten noch Reserven für einen Plan B. Wir fanden das Team sehr gut und meinten, sie hätten eine zweite Chance verdient.»
Diese zweite Chance nutzte Symetis. Nach erfolgreichen Tierversuchen wurde das System weiter verfeinert, um es als Nächstes an Patienten testen zu können.
In den folgenden Monaten entwickelte das Team nicht nur einen benutzerfreundlichen Katheter, mit dem Operationen effizienter durchgeführt werden konnten. Sie fanden auch ein Partnerunternehmen in Brasilien, das aus Herzklappensegeln von Schweinen künstliche Herzklappen herstellte.
Die Vorbereitungen wurden relativ zügig abgeschlossen, obwohl es einige Pannen gab und der Stent noch modifiziert werden musste. Doch im November 2009 war es schliesslich so weit: Prof. Thomas Walther am Herzzentrum Leipzig erklärte sich bereit, das neue Produkt einzusetzen, und Symetis konnte den ersten Test an einem Patienten durchführen.
Am Vorabend der Operation diskutierten Jacques Essinger Stéphane Delaloye bei einem Glas Bier im Hotel Diani in Leipzig über ihren langen gemeinsamen Weg. Beide waren angespannt und die Nervosität hielt bis zum Ende der Operation am nächsten Tag an. «Ich erinnere mich noch genau, wie ich die Operation am Bildschirm verfolgte. An einem Punkt schrie ich, der Stent müsse höher gesetzt werden – obwohl mich natürlich niemand hören konnte. Am Schluss ist aber alles gut ausgegangen.»
Nach dieser ersten erfolgreichen Operation wurden von November 2009 bis Juli 2011 klinische Studien für die Produktzulassung durchgeführt. Einer der ersten Patienten war der damals 86-jährige Ernst Formhals, der an einer schweren symptomatischen Aortenstenose litt. Er konnte nur schwer atmen und Alltagsbelastungen wie Treppensteigen fielen ihm schwer.
Seine Lebensqualität verbesserte sich jedoch schon wenige Tage nach dem Eingriff. «Zwei oder drei Tage nach der Operation fühlte ich mich so gut, dass ich schon nach Hause wollte», erinnerte sich der heute 91-Jährige vier Jahre später in einem Interview. «Ich hatte keine Schmerzen und konnte das Krankenhaus nach einer Woche verlassen. Seit der Operation hatte ich nie wieder Probleme. Ich habe inzwischen ganz vergessen, dass ich eine künstliche Herzklappe habe.»


Michaela Dobos und Hagen Gollnick von Symetis bereiten einen Katheter für den Eingriff vor. Dazu müssen sie die künstliche Herzklappe am Stent befestigen, bevor sie ihn zusammenfalten und in den Katheter einführen...
Auch viele Ärzte sind vom Symetis-System überzeugt. «Was das Symetis-System wirklich von anderen Transkatheter-lösungen unterscheidet, ist seine hohe Anwendungsfreundlichkeit. Es funktioniert fast wie eine Smartphone-App», erklärt Stefan Toggweiler vom Kantonsspital Luzern. Er hat schon mehr als 150 Operationen mit dem Symetis-System durchgeführt. Bis Ende 2017 sollen es über 200 Eingriffe werden. «Der grosse Vorteil ist nicht nur, dass wir Operationen am offenen Herzen vermeiden können. Man benötigt beim Einsatz des Symetis-Produkts zudem eine viel geringere Menge an Kontrastmittel im Vergleich zu anderen Transkathetersystemen, und es muss seltener ein zusätzlicher Herzschrittmacher eingesetzt werden.»
Bei vielen Systemen der ersten wie auch bei einigen der zweiten Generation ist der Stent schwieriger zu positionieren. Daher braucht der Chirurg bis zu 150 Milliliter Kontrastmittel, um den Vorgang klar genug auf dem Monitor zu erkennen. Bei Symetis benötigt man nur rund ein Zehntel dieser Menge. Dies bedeutet weniger Stress für ältere Patienten, die unter Nierenschwäche leiden. Weil der Stent ausserdem in der verkalkten Klappenöffnung sitzt, wird fast jeglicher Druck auf andere Teile des Herzens vermieden. Letzteres kann im schlimmsten Fall noch zusätzlich einen Herzschrittmacher erforderlich machen.


.... Dieser Prozess muss schnell gehen und in einer kühlen Umgebung erfolgen, um die besonders hohe Flexibilität des aus einer Nickel-Titan-Legierung bestehenden Stents zu erhalten.
rem Neustart mit Symetis im Jahr 2005 viel erreicht», erläutert Jacques Essinger. «Nachdem wir 2006 praktisch zu zweit dastanden, beschäftigen wir heute rund 100 Mitarbeitende in Ecublens in der Westschweiz und weitere 140 Kollegen in Brasilien und sind heute mit Boston Scientific Teil einer starken Gruppe. Inzwischen haben wir Tausenden Patienten zu einem besseren Leben verholfen. In den schwierigen Zeiten, die wir zu überstehen hatten, konnten wir auf grossartige Partnerschaften wie die mit Karl Ludwig von Segesser, Thomas Walther und Reinhard Ambros bauen.»
Auch Reinhard Ambros zeigt sich mit der Leistung zufrieden. «Wenn wir heute einer Firma Kapital geben, dauert es zwischen fünf und acht Jahren, bis ihre Technologie ausgereift ist und eine Übernahme durch Novartis oder ein anderes Pharmaunternehmen möglich wird. Dabei ist es sehr schwierig, heute vorherzusehen, was in fünf bis acht Jahren für die Industrie interessant sein könnte. Vereinfacht kann man Folgendes sagen: Wenn ein Projekt von strategischer Bedeutung für die Gesundheitsbranche ist, einen Unterschied für die Patienten macht und zudem finanziell attraktiv ist, sind wir dabei. Im Fall von Symetis kamen alle drei Faktoren zusammen. So etwas hat man selten – aber wenn Präzision und Ausdauer aufeinandertreffen, ist es möglich.»