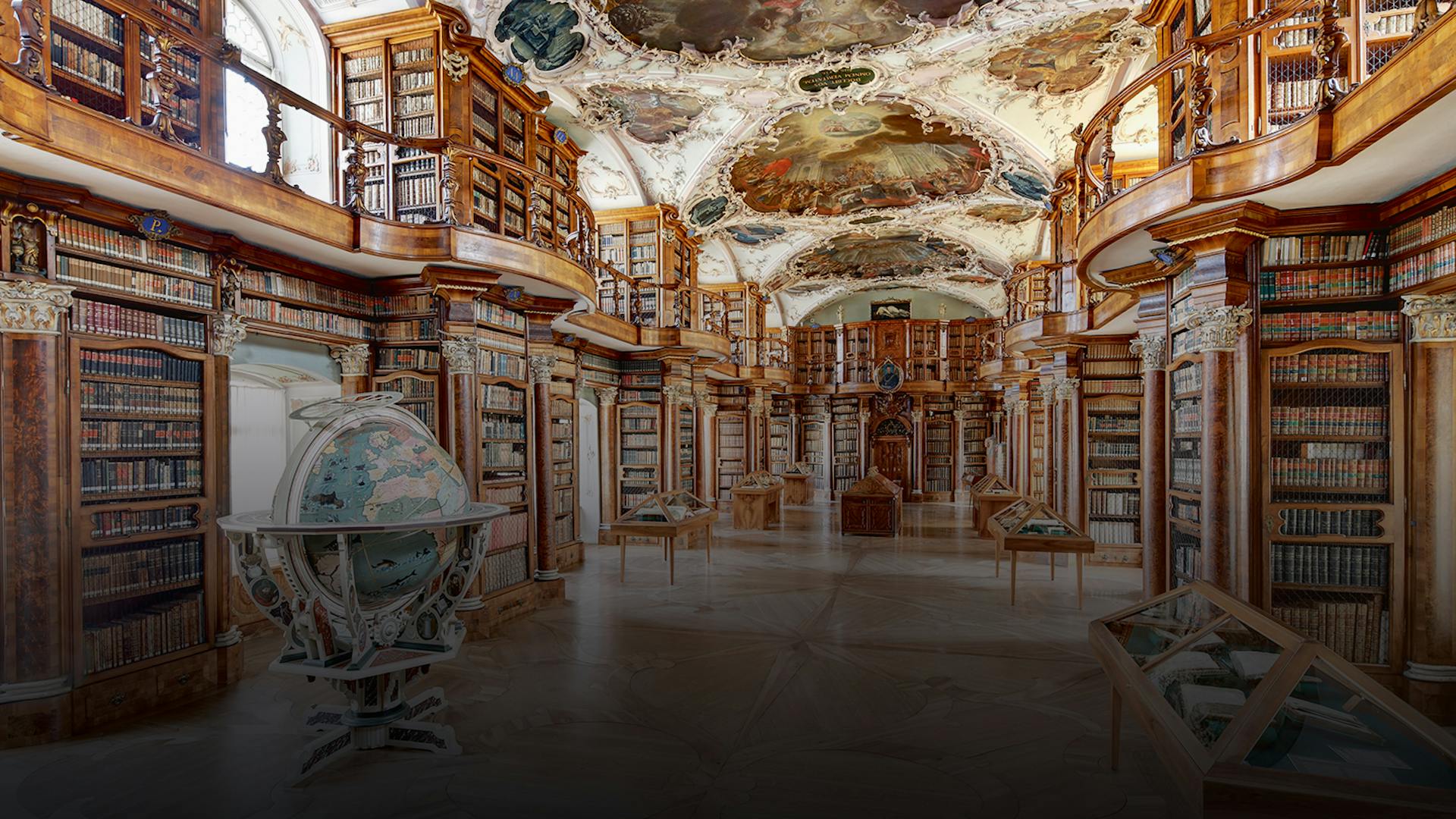Echter Lavendel (Lavandula angustifolia). Linalool und Linalylacetat sind die Hauptduftträger des Lavendelöls und helfen bei Unruhe, Migräne oder Blähungen.
Dieser Artikel wurde ursprünglich im April 2014 publiziert.
Publiziert am 15/06/2020
Gleich nach der Chemie ist die Botanik Eric Francottes zweite Leidenschaft. «An jeder Blüte, die ich sehe, muss ich auch gleich riechen, um ihren Duft zu erfahren», gibt er zu. Und so liegt es nahe, dass der Belgier – nachdem er im Jahr 1980 an der Universität Genf seinen Post-Doc über die Totalsynthese des Naturstoffs Lisergsäure, eines Derivats des Mutterkorns, absolviert hat – mit dem Gedanken spielt, Parfümeur zu werden: «Viele der in der Industrie verwendeten Duftstoffe stammen ursprünglich ja aus der Natur.» Weil aber dann seine gute Nase mehr im Zentrum stünde als sein chemisches Gespür, zieht er es schliesslich vor, ein anderes Jobangebot zu berücksichtigen, und steigt bei der damaligen Ciba-Geigy ein. Und auch hier stehen gewisse Naturstoffe schon bald im Zentrum seiner Arbeit. Heute, 30 Jahre später, ist der Chemiker immer noch bei Novartis tätig, mittlerweile als Executive Director GDC Preparations & Separations.
Gleich und doch anders
Bei Ciba-Geigy beschreitet Eric Francotte zunächst unbekanntes Terrain: Als einer der ersten pharmazeutischen Chemiker erforscht er in den 1980er-Jahren die sogenannte Chiralität, oder Händigkeit, von Molekülen. Dies bedeutet, dass sich zwei Moleküle zueinander wie Bild und Spiegelbild verhalten, ohne aber deckungsgleich zu sein. Doch auch grössere Gegenstände können chiral sein, beispielsweise unsere zwei Hände: Würde man zwischen ihnen einen Spiegel platzieren, sähe das Spiegelbild der linken Hand aus wie die rechte. Dass beide Hände nicht deckungsgleich sind, versteht man spätestens, wenn man versucht, den rechten Handschuh über die linke Hand zu ziehen. Bei chemischen Molekülen bezeichnet man diese beiden «Spiegelbilder» als Enantiomere.
Obwohl sie die gleichen chemischen Eigenschaften haben, unterscheiden sich Enantiomere doch häufig in ihrer Wirkung auf den Körper – haben etwa einen unterschiedlichen Geruch oder schmecken anders. Der Naturstoff Limonen existiert in zwei Varianten: Das eine Enantiomer riecht eher nach Orange, während das andere mehr nach Zitrone oder gar Terpen duftet.
Interessanterweise stellt die Natur in den meisten Fällen nur eines der beiden Enantiomere her – das andere Spiegelbild kommt gar nicht oder nur selten vor. Das gilt insbesondere für so wichtige natürliche Stoffgruppen wie die Aminosäuren oder die Kohlehydrate. Warum das Leben nur eine chirale Form selektiert hat, wissen die Forscher noch nicht genau. «Diese Selektivität könnte rein zufällig sein oder ausserirdischen Ursprungs», so Francotte.
Die guten ins Töpfchen
Die pharmazeutische Forschung steht aufgrund dieser Selektivität der Natur jedoch vor einem Problem: Denn während jenes Enantiomer, das mit dem Organismus wechselwirkt, ein potenter Arzneistoff sein kann, ist sein Spiegelbild sehr häufig wirkungslos – und manchmal sogar schädlich.
Im Labor sieht man sich häufig mit dieser Situation konfrontiert. Denn anders als im menschlichen Körper, wo selektive Enzyme die Stoffwechselprozesse steuern, können gängige chemische Verfahren nicht zwischen Bild und Spiegelbild eines Stoffes unterscheiden. Bei der chemischen Synthese entsteht also in der Regel ein Gemisch von Enantiomeren. Um nun herauszufinden, welches Enantiomer für die gewünschte Wirkung verantwortlich ist, müssen die Forschenden die beiden Formen voneinander trennen, um sie dann unabhängig voneinander untersuchen zu können.
Für diese Trennung fehlten lange geeignete effiziente und allgemeine Methoden. Hier leistet Eric Francotte in den 1990er-Jahren bei Ciba-Geigy einen wichtigen Beitrag: Mit seiner Forschung avanciert er bald zu einem der Pioniere bei der Identifizierung und Trennung von Enantiomer-Gemischen. Das Prinzip seines chromatographischen Verfahrens ist simpel: «Um Chiralität zu erkennen, braucht man ein chirales Instrument», erklärt er. Die Natur bedient sich dazu bekanntermassen der Enzyme – und auch Eric Francotte findet seine Instrumente in der Natur: Er verwendet die beiden chiralen Kohlehydrate Amylose (Stärke) und Cellulose (aus den Zellwänden von Pflanzen oder Baumwolle) und setzt sie chemisch modifiziert als Trägermaterial in der Chromatographie ein. Gibt man dazu ein Gemisch von Enantiomeren, interagiert das Trägermaterial unterschiedlich mit den beiden Enantiomeren – oft bleibt das eine gut am Trägermaterial haften, das andere dagegen kaum. Sie werden auf diese Weise voneinander getrennt und können nun leicht isoliert und identifiziert werden.
Breite Anwendung
Für seine Leistungen wurde Francotte mehrfach ausgezeichnet, 1995 mit dem Ciba Fellow Award, 1998 mit einer Auszeichnung der Universität Genf und schliesslich 2000 mit dem bedeutenden Novartis Distinguished Scientist Award. Heute besitzt sein Verfahren in der pharmazeutischen Forschung einen grossen Stellenwert und trug massgeblich zur Entwicklung zahlreicher Produkte von Novartis bei. «Die pharmazeutische Industrie kann es sich heute nicht mehr leisten, eine Mischung von Enantiomeren auf den Markt zu bringen», sagt Francotte. «Ein Medikament mit einem einzigen Spiegelbild ist wesentlich sicherer und hat weniger Nebenwirkungen.» Chirale Arzneistoffe kommen heute überwiegende als «Enantiomerenreine» Produkte auf den Markt.
So leistete Francottes Labor auch kürzlich einen grossen Beitrag zur Entwicklung von KAE609, einem vielversprechenden Kandidaten zur Behandlung der Malaria. Da der Malariaparasit erste Resistenzen gegen das gängige Artemisinin (Coartem) zeigt, braucht man Alternativen: KAE609 ist besonders vielversprechend, da es den Parasiten mit einem anderen Mechanismus angreift als Artemisinin. Entwickelt wurde KAE609 im Jahr 2007 am Novartis Institute for Tropical Diseases in Singapur – und bald war auch klar, dass der synthetische Stoff aus zwei Enantiomeren besteht. Die Singapurer kamen auf das in Basel ansässige Team von Francotte zu mit der Bitte, zu bestimmen, welche der beiden Formen von KAE609 für die antimalariale Wirkung verantwortlich ist. Mit diesem Wissen können die Forscher nun nach der Synthese die beiden Enantiomere voneinander trennen. Derzeit in Entwicklung befindet sich ein neuer Synthese-weg, der künftig erlauben soll, gezielt nur noch das aktive Enantiomer von KAE609 herzustellen und so nicht grosse Mengen des falschen Enantiomers entsorgen zu müssen. Parallel durchläuft KAE609 aktuell Phase II der klinischen Untersuchungen.
Chiralität ist überall
«Unsere Methode ist nicht das einzige Trennverfahren auf dem Markt», sagt Francotte. «Aber es ist breit anwendbar und wir produzieren die grösste Ausbeute und den geringsten Abfall.» 1996 wurde das Verfahren patentiert, 1998 an die japanische Daicel Chemical Industries verlizenziert und inzwischen kommt es weltweit zur Anwendung, auch bereits im industriellen Produktionsmassstab.
Was macht Eric Francotte nach mehreren Jahrzehnten in der Chiralitätsforschung bei Novartis, nach der erfolgreichen Verbreitung seines Lebenswerks und nach mehreren namhaften Auszeichnungen? «Jede Anwendung lässt sich noch weiter perfektionieren», sagt er bescheiden. Derzeit arbeitet er daran, die organischen Lösungsmittel in der Chromatographie durch flüssiges CO2 zu ersetzen, das umweltschonender ist. Auch privat widmet er sich seiner Leidenschaft. Er fotografiert chirale Objekte, wo immer er ihnen begegnet: Säulen mit Spiralmuster, Schneckenhäuschen, Tiere, Kunstobjekte – und am liebsten natürlich die duftenden, schraubigen Blüten von Pflanzen.