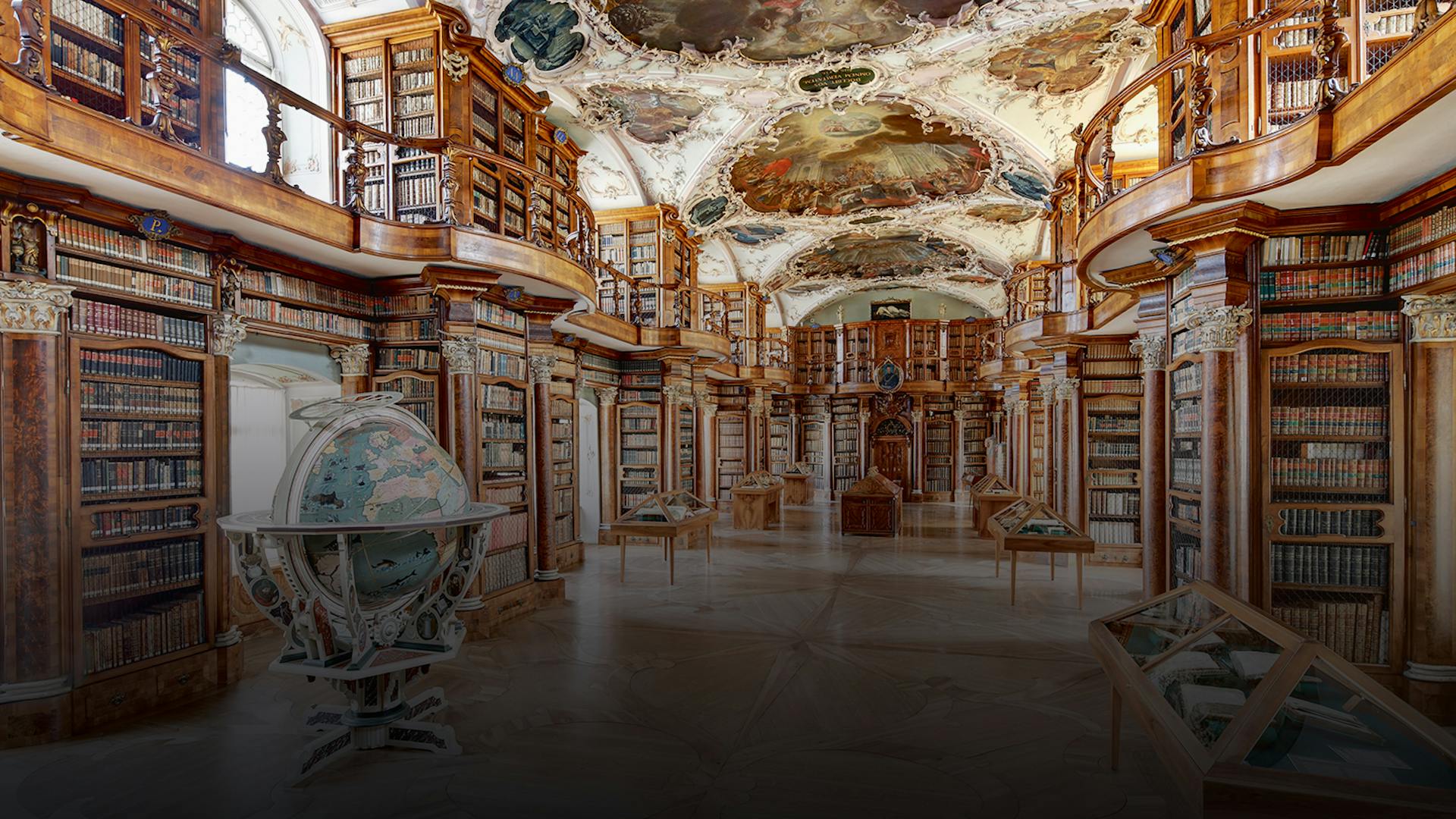«Nur wenn wir die molekularen und zellulären Mechanismen verstehen, durch die Krebs und Metastasen entstehen, können wir die Behandlung und die Vorbeugung dieser Krankheit massgebend beeinflussen», Mohamed Bentires-Alj.
Dieser Artikel wurde ursprünglich im Juni 2015 publiziert.
Publiziert am 15/06/2020
Statistisch gesehen erkrankt jeder dritte Schweizer einmal in seinem Leben an Krebs. Doch so unterschiedlich die Patienten, so verschieden auch die Krebsformen – insgesamt gibt es über 200 Tumorarten. Die heutige Krebsforschung zielt daher auf die Erforschung der molekularen und zellulären Mechanismen, die dazu beitragen, dass Tumore entstehen, wachsen und Metastasen bilden.
«Nur wenn wir die molekularen und zellulären Mechanismen verstehen, durch welche Krebs und Metastasen entstehen, können wir die Behandlung und die Vorbeugung dieser Krankheit massgebend beeinflussen», erklärt Mohamed Bentires-Alj, Gruppenleiter im Bereich Krebsforschung am Basler Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI).
Der Pharmazeut konzentriert sich in seiner Forschung auf den Brustkrebs, die häufigste Tumorerkrankung bei der Frau. Das Brustkrebsrisiko steigt, je früher die erste Menstruation einsetzt, je später die Frau schwanger wird und je später sie schliesslich die Menopause erreicht. «Weibliche Hormone haben Einfluss auf die Entwicklung der Brust – und wahrscheinlich auch auf die Entstehung von Brustkrebs», so Bentires-Alj, der auch die Mechanismen untersucht hat, die nach einer frühen Schwangerschaft vor Brustkrebs schützen.
Tumorstammzellen als Angriffspunkt
In der Schweiz erkranken jedes Jahr über 5500 Frauen und 40 Männer an dieser Krebsart – inzwischen überleben aber zwei Drittel der Patientinnen 10 Jahre oder länger, nach einer Therapie. Die meisten Todesfälle sind auf Metastasen zurückzuführen.
«Eine der wichtigsten und interessantesten Herausforderungen in der Krebsbiologie ist die Verschiedenartigkeit der Tumore. Sie fasziniert mich immer wieder und hat auch enorme klinische Konsequenzen. Die Heterogenität der Tumore zieht sich wie ein roter Faden durch meine Arbeit», kommentiert Bentries-Alj. Mit dem Enzym SHP2 konnte Bentires-Alj kürzlich einen Marker identifizieren, der mit schlechten Tumorprognosen einhergeht. «Wir fanden heraus, dass SHP2 wesentlich zur Progression des Krebses beiträgt und die Zellen erhält, die Tumore auslösen.»
Dabei spielt SHP2 vor allem in den sogenannten Krebsstammzellen eine Rolle. Das sind spezielle Zellen innerhalb eines Tumors, die als einzige in der Lage sind, den Tumor am Leben zu erhalten. Man vermutet auch, dass sie bei der Metastasenbildung und bei Therapieresistenzen eine Rolle spielen. SHP2 ist daher ein vielversprechender Angriffspunkt für eine medikamentöse Therapie.
Brückenbauer
Für Bentires-Alj ist es zentral, dass seine Erkenntnisse früher oder später den Weg in klinische Anwendungen finden. «Wir sind ganz am Anfang einer Ära, in der wir Krebs als eine organismische Krankheit ansehen und in der Resultate der Grundlagenforschung in der Klinik Anwendung finden», sagt Bentires-Alj. Der gebürtige Marokkaner unterstützt darum den Wis-senstransfer und die Interdisziplinarität immer wieder, zum Beispiel indem er 2009 das europäische Brustkrebs-Forschungsnetz «European Network for Breast Development and Cancer Labs» initiierte, das er seither präsidiert und das viel Anerkennung unter Fachleuten geniesst. Auch in der Region Basel fördert er den Austausch zwischen Universität, Klinik und Industrie durch die Gründung des Basel Breast Consortium (BBC). Der Plan ist, das BBC auf Forschungsinstitute, Firmen und Spitäler in der ganzen Schweiz auszudehnen.
Auch die Industrie suche stärker den Kontakt zur akademischen Forschung, ist Bentires-Alj überzeugt: «Man will heute sehr genau verstehen, warum Tumore so heterogen sind und eine Therapie wirkt, und was mögliche unerwünschte Nebenwirkungen sein könnten, bevor man einen Arzneistoff auf den Markt bringt.» Nach seinem Postdoc an der Harvard Medical School in Boston wählte er denn auch das FMI mit Bedacht als seine nächste Station, da das mit den Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) und der Universität Basel affiliierte Institut dafür bekannt ist, eng mit den Hochschulen und der Industrie zusammenzuarbeiten. In den letzten Jahren kam es zu zahlreichen Kooperationen mit verschiedenen NIBR-Forschungsgruppen aus den Bereichen Oncology, Autoimmunity, Transplantation & Inflammatory Diseases (ATI), Developmental and Molecular Pathways (DMP) und mit dem Center for Proteomic Che-mistry (CPC) sowie in Projekten mit der Division Pharma.
«Die Zusammenarbeit mit Prof. Mohamed Bentires-Alj vom FMI ist ein gutes Beispiel für die kooperative Kultur zwischen den NIBR und unseren angeschlossenen Institutionen», sagte Dhaval Patel, Head NIBR Europe. «Mit unserem komplementären Know-how und Expertenwissen in den Bereichen Immunologie und Tumorbiologie konnten wir neue Erkenntnisse über die Mechanismen von Brustkrebsmetastasen gewinnen.»
«Erleichtert wurde die Zusammenarbeit auch dadurch, dass ich viele NIBR-Forschende bereits gut kannte, da wir schon in Harvard zusammen gearbeitet hatten», blickt Bentires-Alj zurück.
Immunzellen im Einsatz
Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht mit den Wissenschaftlern von ATI – eine, vielleicht erst auf den zweiten Blick, einleuchtende Kombination: Doch gerade das körpereigene Immunsystem spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Krebs und wird von Wissenschaftlern mit immer neuen Methoden entsprechend eingesetzt. So kann man sich zum Beispiel das Immunsystem zu Nutze machen, um Krebszellen zu attackieren. Ausserdem koppeln innovative Arzneimittel einen Wirkstoff an die Antikörper und bringen diesen so ganz gezielt zur Tumorzelle. Wohingegen die klassische Chemotherapie auf alle Zellen des Körpers wirkt, selbst die gesunden, was auch die starken Nebenwirkungen erklärt. Schon lange arbeiten darum Onkologen und Immunologen Hand in Hand. Beide Disziplinen lagen Bentires-Alj schon früh am Herzen: «Nach dem Studium musste ich mich zunächst für eine Richtung entscheiden und wählte die Krebsforschung. Doch dank der Immunonkologie kann ich heute beide Interessen verbinden.»
Erstens kommt es anders …
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit ATI kam es im November 2014 zu einer vielbeachteten Publikation in der Fachzeitschrift «Nature». Bentires-Alj und sein Novartis Kollege Tobias Junt zeigen darin, dass ein bisher vielversprechender Ansatz zur Behandlung von metastasierendem Brust-krebs äusserst negative Auswirkungen hat, sobald man die Behandlung absetzt.
Der untersuchte Wirkstoff hemmt das Signalmolekül CCL2. Dieses ist nämlich dafür bekannt, Monozyten – weisse Blutzellen – zum Tumorherd zu locken, wo sie die Progression des Tumors und die Bildung von Metastasen fördern. «Wir wollten die Tumorheterogenität umgehen, indem wir in der homogeneren Mikroumgebung des Tumors eingreifen und es hat funktioniert: Die Neutralisierung von CCL2 wirkte sich zwar nicht auf das Tumorwachstum aus, aber es reduzierte die Bildung von Metastasen massiv», sagt Bentires-Alj.
Doch Bentires-Alj und Junt wollten wissen, was geschieht, wenn diese Therapie abgesetzt wird. Sie stellten überraschend fest: Ein Abbruch der Therapie hat verheerende Folgen. Es kam zu einer beschleunigten Metastasenbildung. Die Monozyten, die durch den Hemmstoff im Knochenmark gebunden worden waren, strömten jetzt zum Tumor und zu bereits bestehenden Metastasen zurück – als ob gar keine Therapie stattgefunden hätte.
Für Bentires-Alj ist klar, dass die Forschung gründlich und behutsam vorangetrieben werden muss. «Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man in die Tumormikroumgebung eingreift», erklärt Bentires-Alj. Zwar können Therapien, die auf das Immunsystem des Patienten zurückgreifen, extrem hilfreich sein. «Doch nur, wenn man die molekularen Mechanismen versteht und abschätzen kann, was ein Eingriff auch auf lange Sicht bewirken kann.» Das heisse nicht, dass eine CCL2-Behandlung nun überhaupt nicht eingesetzt werden könne. Vielmehr raten die Wissenschaftler, zusätzlich weitere Therapien einzusetzen, um den beobachteten Effekt auszubremsen. Die Resultate von Bentires-Alj und Junt liefern gute Hinweise, wie das gehen könnte.