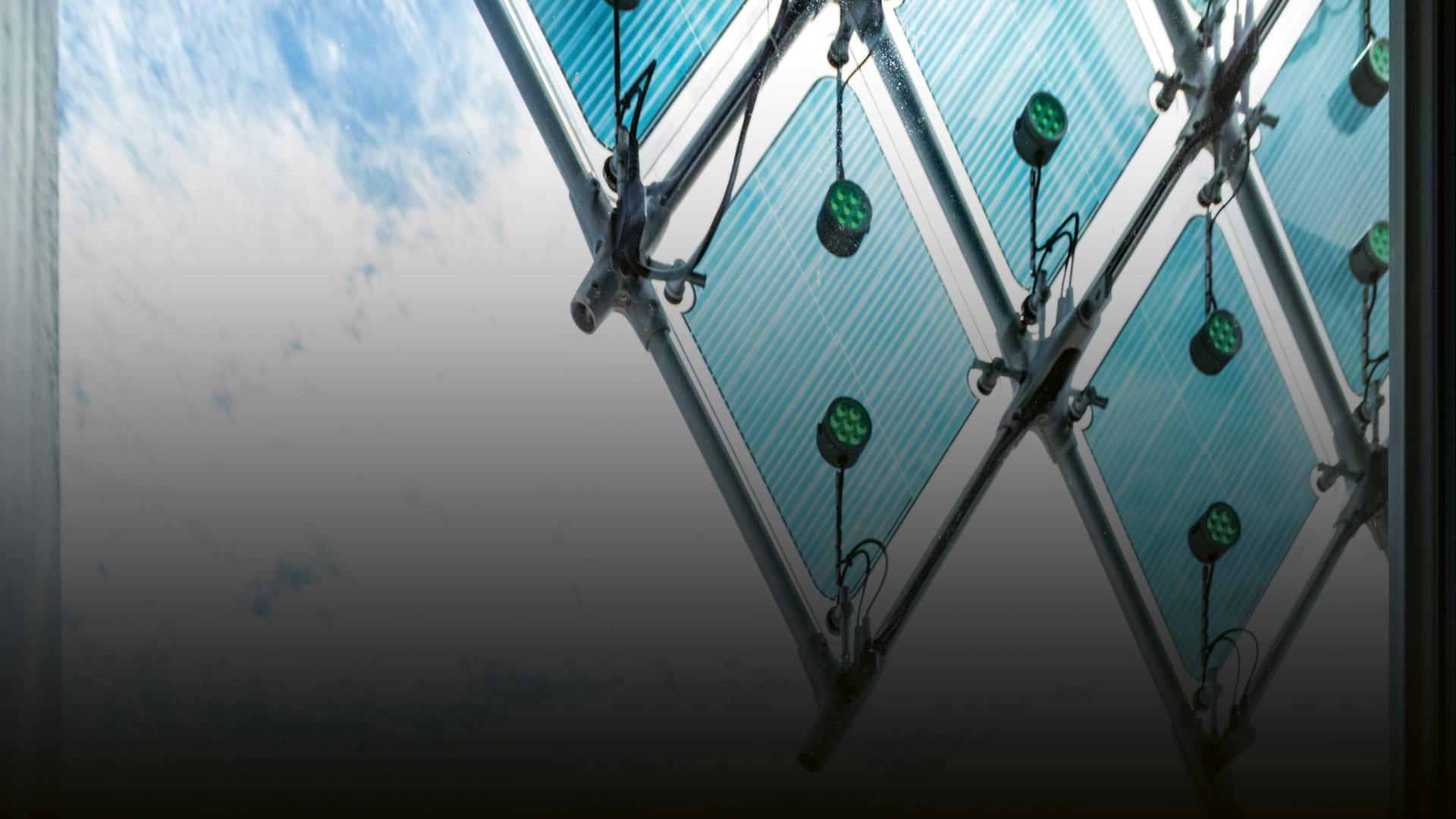Baum um Baum entsteht...
 Inhalt
Inhalt Klassisch mit fremd-farbigen Akzenten
Klassisch mit fremd-farbigen Akzenten Suche nach einer Symbiose
Suche nach einer SymbiosePubliziert am 30/05/2022
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Bäume seltene Gäste auf dem Industrieareal St. Johann in Basel. Eher geduldet als geplant wuchsen sie in Nischen neben Bahngeleisen und eng beieinanderstehenden Laborgebäuden, Fabrikationshallen und Bürohochhäusern. Grossflächige Parks suchte man damals vergebens.
Mit dem 2001 entworfenen Campus-Masterplan des italienischen Städteplaners und Architekten Vittorio Magnago Lampugnani, in dem gleich mehrere Grünanlagen vorgesehen waren, änderte sich die Situation grundlegend. Es entstanden weithin Grünflächen, die nicht nur eine Wohltat für das Auge sind, sondern auch helfen, dass sich die Mitarbeitenden auf dem Areal aktiv erholen können oder die Möglichkeit für informelle Treffen zum fachlichen Austausch haben – sei es in einem lauschigen Wäldchen oder beim Sonnenbaden auf den grosszügigen Wiesen.
Eine der grössten Anlagen ist der sogenannte Park South, der seit 2007 den Abschluss des Campus gegen Süden hin bildet und mit über 1000 Bäumen eine grüne Oase mit bunter Fauna und Flora darstellt, die zum Spazieren und zur Erholung einlädt.
Ursprüngliche Landschaft
Die Bedeutung des Parks geht allerdings weit über eine blosse Ansammlung von Bäumen und Sträuchern hinaus. Hier wurde versucht, eine frühzeitliche Landschaft nachzustellen, die heute unter dichten Siedlungs- und Nutzungsstrukturen verborgen liegt: die von Gletschern und Flüssen geformte Landschaft des Basler Rheintals.
Entwickelt wurde das Projekt von Vogt Landschaftsarchitekten aus Zürich in Zusammenarbeit mit dem Generalplaner-Team unter der Leitung von Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten aus Basel. Beide Büros verfügen über grosse Erfahrung in der Projektierung und Realisierung städtischer Freiräume.
Neben dem Park South haben Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten als Generalplaner die meisten grösseren Grünräume auf dem Novartis Campus umgesetzt, zu denen neben den nördlich am Rhein liegenden Park Nord und Square auch der Physic Garden gehört, eine Gartenanlage mit Medizinalpflanzen, die an die Ursprünge der Medizin erinnern. Vogt Landschaftsarchitekten wiederum verantworteten auf dem Novartis Campus das Design der Grünanlage vor dem Gehry-Gebäude sowie das Laborgebäude von Rahul Mehrotra, das durch seine innovative Begrünung der Fassade und der Innenräume besticht.