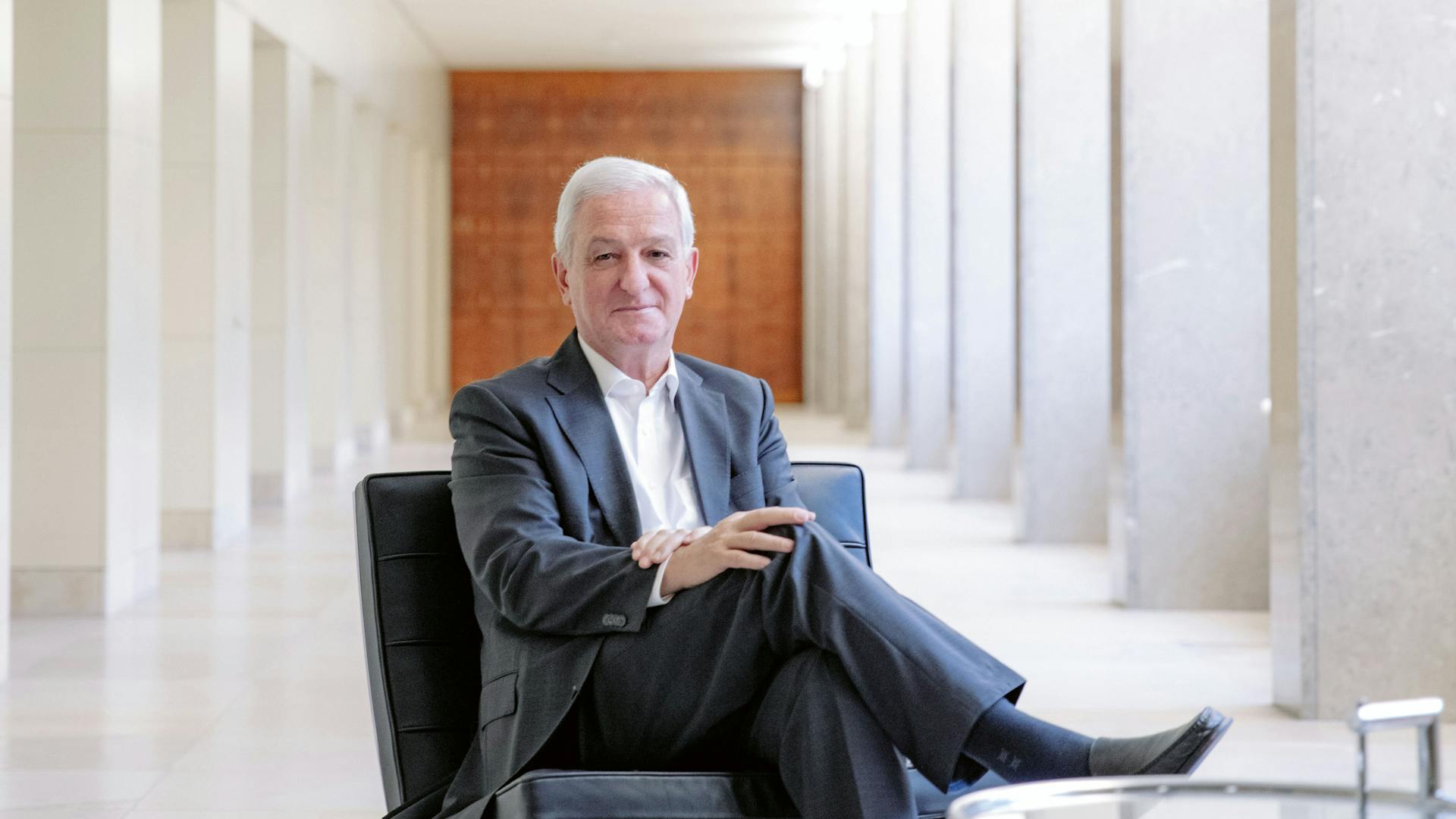
«Wir suchen den Austausch mit der Bevölkerung»
Text von Goran Mijuk, Fotos von Adriano Biondo





Jörg Reinhardt war regelmässig auf der Pavillon-Baustelle...
Publiziert am 06/04/2022
Als Jörg Reinhardt 1982 zur damaligen Sandoz in Basel stiess, hatte er wohl kaum einen Gedanken an die Möglichkeit verschwendet, rund 30 Jahre später als Verwaltungsratspräsident eines der grössten Gesundheitsunternehmen der Welt zu leiten. Die Promotion hinter sich und jung verheiratet, war er froh, eine Stelle in der Industrie gefunden zu haben, die ihm erlauben würde, auf eigenen Beinen zu stehen und eine Familie zu gründen.
Aufgrund der damals herrschenden Bestimmungen konnte er nicht in die Schweiz ziehen und erwarb deshalb im nahen Freiburg im Breisgau ein Haus. Und auch wenn seine Frau über diesen Schritt zunächst nicht sonderlich erfreut war, da sie den Kauf als zu risikoreich betrachtete, so machte sich der damals knapp 26-jährige Reinhardt keine übertriebenen Sorgen. Schon früh hatte er lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen.
«Der Mut, etwas Neues zu wagen, ist sicherlich zum Teil meinem Charakter geschuldet, aber auch der Tatsache, dass ich bereits in jungen Jahren auf eigenen Beinen stehen musste», erklärt Reinhardt. «Da entwickelt man gewisse Eigenschaften, die einem helfen, in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren, aber auch mutig zu sein und mit einer guten Portion Zuversicht einen Schritt ins Unbekannte zu machen.»
Seine beruflichen Fähigkeiten und vor allem seine klar strukturierte Denk- und Handlungsweise fielen bei Kollegen und Vorgesetzten früh auf. Marc Moret, der gestrenge Sandoz-Patron, der das Unternehmen beinahe wie ein General führte, lud ihn bereits nach kurzer Zeit zu einem Essen ein, um mehr über den gebürtigen Saarländer zu erfahren.
Eine Einladung von Moret war nicht bloss ein unverbindlicher Business-Lunch. Vielmehr war es eine Art Screening, dem man sich nicht entziehen konnte. Moret hatte im jungen Pharmazeuten wohl schon früh grosses Führungspotenzial gesehen. Und sein Instinkt täuschte ihn nicht. Mit den Jahren wurde der Verantwortungsbereich, der Reinhardt zugetragen wurde, immer breiter, bis er mit 38 die Gesamtleitung der pharmazeutischen Entwicklung der Sandoz übernahm.
Zwei Jahre später kam es zur Fusion zwischen Sandoz und Ciba-Geigy, die Reinhardt, wie viele Mitarbeitende dieser Zeit, als grosse Überraschung wahrnahm. «Eigentlich hatte das niemand auf dem Radar. Der Zusammenschluss von zwei Unternehmen, die je rund 70000 Mitarbeitende umfassten, sprengte die Vorstellungskraft jener Zeit. So was hielt niemand für möglich, vor allem nicht in der Schweiz.»
Dass sich der damals weltweit grösste Zusammenschluss der Industriegeschichte für Reinhardt als weiteres Sprungbrett erweisen und ihm die Möglichkeit geben würde, an der Entwicklung wichtiger medizinischer Durchbrüche beteiligt zu sein, lag nicht sofort auf der Hand. Denn die Karten wurden neu gemischt und es galt, sich gegen harte Konkurrenz durchzusetzen.
Reinhardt verantwortete zunächst die präklinische Entwicklung, bis ihm die Gesamtleitung der pharmazeutischen Entwicklung von Novartis übertragen wurde. Im Nachhinein war dies ein Glücksgriff. Denn in nur wenigen Jahren gelang es der Entwicklungsorganisation unter der Leitung von Reinhardt, mit dem Herzmedikament Diovan und der Krebstherapie Glivec gleich zwei wichtige Therapien auf den Markt zu bringen, die Novartis medizinisch und geschäftlich zu einem Quantensprung verhalfen.
Als Teamplayer und Wissenschaftler, der den zähen Forschungs- und Entwicklungsprozess eines Medikaments aus nächster Nähe kennt, stieg ihm dieser Erfolg nicht zu Kopf. Zudem wurde ihm schon bald auch die herausfordernde Aufgabe zugeteilt, das Impfstoffgeschäft von Novartis aufzubauen. Und obwohl sein Team alles daransetzte, diesen Bereich zu einer erfolgversprechenden Division zu entwickeln, ging der Prozess nur schleppend voran und der durchschlagende Erfolg liess auf sich warten.
Dass er die Division zusammen mit dem Tiergesundheitsbereich und dem Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten von Novartis abspaltete, nachdem er 2013 zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde, hängt sicherlich mit dieser Erfahrung zusammen. Doch vor allem stand die strategische Überzeugung dahinter, dass sich Novartis nur dann erfolgreich weiterentwickeln kann, wenn sich das Unternehmen in wachstumsstarken Märkten etabliert und dort eine Spitzenposition einnimmt.
«Als Novartis 1996 gegründet wurde, galten Mischkonzerne, die in verschiedenen industriellen Bereichen tätig waren, als Erfolgsmodell, weil damit das Geschäfts-risiko minimiert werden konnte», erklärt Reinhardt. «Doch dieses Modell wurde zunehmend infrage gestellt, zumal sich die Innovationsgeschwindigkeit rasant beschleunigte. Angesichts der technologischen Entwicklung kann man es sich nicht leisten, überall dabei zu sein. Man muss sich fokussieren.»
Neben der Konzentration auf das Kerngeschäft leitete Jörg Reinhardt als Verwaltungsratspräsident auch einen Kulturwandel beim Unternehmen ein. Dieser zielte vor allem darauf ab, verstärkt die Zusammenarbeit zu fördern und die Transparenz des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft zu erhöhen.
«Als ich vor über drei Jahrzehnten zum Unternehmen stiess, war vieles sehr hierarchisch geprägt. Es gab wenig Flexibilität und die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen war marginal. Auch Transparenz gegenüber der Gesellschaft wurde kaum diskutiert. Unternehmen waren in der Regel in sich geschlossene Gebilde, die sich wenig darum kümmerten, was ausserhalb ihrer selbst gesetzten Grenzen passiert.»
Neue technologische Entwicklungen, aber auch der stetig steigende gesellschaftliche Druck führten zu einem Umdenken. «Ich habe mich schon früh daran gestört, dass nur selten über die Funktions- und Divisionsgrenzen hinaus zusammengearbeitet wurde. Ausserdem fand ich den Austausch mit dem Rest der Gesellschaft schon immer ausbauwürdig. Klar, man kann es nicht jedem recht machen. Aber man muss sich schon hinstellen und sich die Argumente der Leute anhören. Das wurde in der Vergangenheit zu wenig gemacht.»
Mit dem Pavillon soll sich diese kulturelle Entwicklung nun weiter beschleunigen. Denn Novartis will im Pavillon nicht nur Aufklärungsarbeit leisten und Besucherinnen und Besucher anziehen, die mehr über die Pharmaindustrie erfahren wollen. Der Pavillon soll auch ein Ort sein, wo sich die Leute austauschen und Debatten geführt werden können, gleichgültig, um welche Themen es sich dabei handelt.
«Ich glaube, die Welt hat sich heute so stark verändert, dass wir als Unternehmen eine Art Bringschuld haben, um unsere Position klarzumachen», führt Reinhardt aus. «Wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen sich von selbst mit uns beschäftigen. Wir müssen schon klare Zeichen setzen, dass wir einen Austausch wollen und diesen ehrlich suchen. Dies entspricht der gesellschaftlichen Entwicklung und deckt sich mit unserer Vorstellung einer offenen Arbeitskultur.»


...um die Fortschritte vor Ort zu begutachten und mit den Architekten zu diskutieren.
Herr Reinhardt, wie kam es dazu, dass Novartis einen Pavillon gebaut hat, um der Bevölkerung die pharmazeutische Industrie näherzubringen?
Die Idee des Novartis Pavillon geht einige Jahre zurück. Sie drehte sich zunächst um den Begriff des Lernens und wie wir in einem Wissenschaftskonzern damit umgehen, vor allem wenn es um die Weiterbildung der eigenen Leute geht, sowohl was die technische Fortbildung, aber auch die Führungskompetenz betrifft. Im Verlauf der Diskussion ist aber zusehends klarer geworden, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, der Bevölkerung die Pharmaindustrie näherzubringen. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, den Pavillon so umzusetzen, wie er heute steht.
Hat die Pharmaindustrie hier einen Nachholbedarf?
Nicht nur. Ich glaube, viele Industrien sind heute aufgefordert, sich zu erklären und mehr Transparenz zu schaffen. Denken Sie nur an die grossen Technologiekonzerne, deren Aktivitäten unser tägliches Leben beeinflussen. Das Bedürfnis der Bevölkerung ist sehr gross, mehr zu erfahren und sich auszutauschen. Aber auch die Pharmaindustrie, mit ihrer hohen Komplexität, muss sich stärker anstrengen, damit die Bevölkerung sich ein besseres Bild davon machen kann, was es alles braucht, um ein Medikament herzustellen.
Was versprechen Sie sich vom Pavillon?
Zunächst einmal ist der Pavillon ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir einen Dialog mit der Gesellschaft anstreben. Wir sagen nicht nur, dass wir einen Austausch suchen. Wir tun es auch. Wir laden die Leute zu uns ein. In einem zweiten Schritt geht es darum, den Menschen zu zeigen, was es mit der pharmazeutischen Industrie auf sich hat und was es alles braucht, um eine Therapie von der Idee zum Patienten zu bringen. Die Ausstellung «Wonders of Medicine», in der wir die verschiedensten Facetten des Gesundheitssektors aufzeigen, zielt darauf ab.
Welche Themen will Novartis ansprechen?
Ein für uns fundamentales Anliegen ist es, dass sich der Pavillon nicht um Novartis selbst dreht. Das ist kein Geschäftshaus im eigentlichen Sinn, sondern ein Begegnungszentrum. Heute lässt sich sicher nicht sagen, wie die Leute auf den Pavillon reagieren und welche Gespräche sich hier entwickeln werden. Viele Dinge sind heute auch von unserer Seite noch absichtlich offen. Wir haben ein interdisziplinäres Gremium mit internen und externen Experten gegründet, das Gesprächsrunden und Events verantworten wird. Dabei sind wir bereit, ein weites gesellschaftliches Themenfeld abzudecken. Und wir werden nicht versuchen, heisse Themen zu unterdrücken.
Wird hier auch über Preise gesprochen werden?
Das ist sicherlich ein Thema, das die Leute bewegt. Und es ist unser Ziel, in solchen Debatten aufzuzeigen, wie Preisfindungen generell zustande kommen und was die Überlegungen seitens der Pharmaindustrie sind. Aber es gibt natürlich viele andere Themen, die die Menschen bewegen und über die diskutiert werden kann. Das spannende an der Pharmaindustrie ist ja, dass sie fast alle Lebens- und Arbeitsbereiche tangiert, sei dies Ethik, Technologie und natürlich Gesundheit. Der Stoff wird uns sicherlich nicht so leicht ausgehen.
Erhoffen Sie sich davon einen Reputationsgewinn?
Der Pavillon ist kein Marketinginstrument. Hier wird nicht Werbung für Novartis oder ihre Produkte gemacht. Aber natürlich erwarten wir, dass wir durch den Pavillon weiter an Visibilität gewinnen und dass uns die Leute grundsätzlich besser verstehen werden, wenn sie sich mit unserer Industrie auseinandersetzen. Dies kann der Reputation von Novartis helfen, aber nur wenn wir es richtig machen und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Auch Basel kann davon profitieren, denn der Novartis Pavillon ist in seiner strategischen und kulturellen Ausrichtung heute sicherlich einzigartig in der internationalen Ausstellungslandschaft.
Auch ein neuer Teil des Schullabors ist künftig im Pavillon untergebracht.
Von dieser Neuerung versprechen wir uns ebenfalls viel. Am neuen Standort und mit der Möglichkeit, die interaktive Ausstellung im Pavillon zu besuchen, hoffen wir, bei Schülerinnen und Schülern Begeisterung für die Wissenschaften und Neugier für das Thema Medizin zu wecken. Das ist ein wichtiger Beitrag, die sogenannten MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – auf spielerische Weise näherzubringen und zur weiteren Popularisierung dieser Themen beizutragen.
Ursprünglich wollte man auch auf dem Campus bauen. Warum hat man sich dagegen entschieden?
Projekte solcher Grössenordnung, die vor allem auch eine kulturelle Message haben, werden nicht von heute auf morgen umgesetzt. Es wurden viele Ideen diskutiert. Ein früher Entwurf sah vor, das Zentrum in einem Laborgebäude auf dem Campus umzusetzen. Es erwies sich aber aus verschiedenen Gründen als unpraktisch. Und als man nach einem neuen Standort suchte, kam der Gedanke auf, ein Gebäude vor dem Campusareal zu bauen. Da wir den Campus ohnehin sowohl für Drittfirmen als auch für die Bevölkerung öffnen, kam zum Ganzen noch eine symbolische Wirkung hinzu.
Viele Beobachter haben die Campusöffnung als eine Art Rückzug von Novartis aus Basel und der Schweiz interpretiert. Ist der Pavillon ein Zeichen, dass Novartis weiterhin in der Schweiz bleibt?
Leider wird immer wieder verkürzt argumentiert. Die Öffnung des Campus wurde von einigen Stimmen mit einem Rückzug aus Basel und der Schweiz gleichgesetzt, weil wir Drittfirmen die Möglichkeit geben, sich bei uns einzumieten. Dem ist nicht so. Unter anderem haben wir jüngst auf dem Campus unsere chemische Forschung zusammengezogen, die bislang grossteils im Klybeck-Areal zuhause war. Und auch das Friedrich Miescher Institute, das im Rosental-Areal beheimatet war, wird in Zukunft auf dem Campus sein und unsere Forschungsaktivitäten bereichern. All das sind klare Zeichen, dass Basel für unsere weltweite Forschung weiterhin zentral bleibt. Und natürlich zeigt der Pavillon auch unsere Verbundenheit zur Stadt Basel und zur Schweiz.
Werden Sie selbst auch den Pavillon besuchen und dort Rede und Antwort stehen?
Sicher werde ich den Pavillon öfters besuchen und freue mich jetzt schon auf den Dialog mit dem Publikum. Aber ich bin nicht der Einzige. Viele Kolleginnen und Kollegen von Novartis werden die Gelegenheit nutzen, sich in diesen Dialog einzubringen und ihr Wissen weiterzugeben. Dabei geht es nicht nur um Dinge, die wir kennen, sondern auch um grosse Menschheits- und Gesellschaftsfragen, die alle noch einer Antwort harren und kontrovers diskutiert werden müssen. Was ist der Wert des menschlichen Lebens? Was darf ein Medikament kosten? Wieso tut sich die Industrie so schwer, Medikamente für Menschen mit seltenen Krankheiten zu entwickeln? Zu einigen dieser Fragen kann es vielleicht nie abschliessende Antworten geben. Aber wir können mit dem Pavillon eine Plattform für den intellektuellen Austausch schaffen, die einen guten Rahmen für ernsthafte Diskussionen bietet.
Erhalten Sie unsere Updates
Jetzt abonnieren. Erhalten Sie die neuesten Artikel des Novartis live Magazins.
Mit dem Absenden Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Novartis AG Ihre E-Mail-Daten für den internen Gebrauch von Novartis, in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und mit geschützten technischen Mitteln erfasst und verarbeitet.





