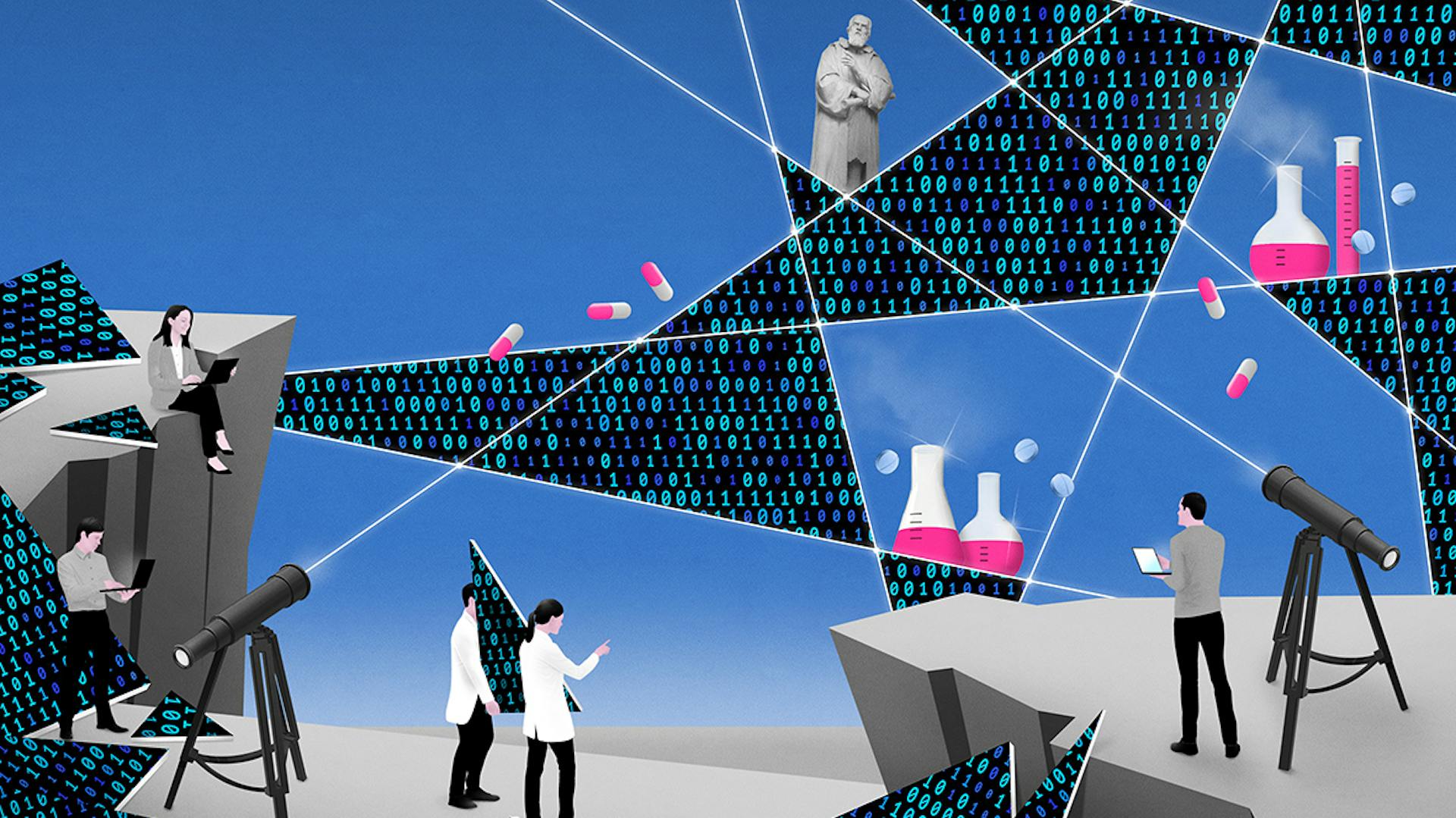Die Anfänge der biologischen Forschung im Bau 133 der Ciba. Aufnahme um 1917.
 Inhalt
Inhalt Gemächliches Tempo
Gemächliches Tempo Hormonforschung
Hormonforschung Durchhaltevermögen
Durchhaltevermögen Kultur als Talentmagnet
Kultur als TalentmagnetPubliziert am 13/09/2021
Als Martin Missbach 1990 bei Ciba-Geigy eintrat, gehörte das Unternehmen bereits zu den grössten Pharmafirmen der Welt und war für einen jungen Chemiker eine Traumdestination, konnte man doch hier, damals im Unterschied zur Universität, bereits intensiv disziplinübergreifend arbeiten.
«Mein Werdegang an der Hochschule war ziemlich speziell, weil ich nicht nur Chemie, sondern auch Biochemie und Molekularbiologie studiert hatte», erinnert sich Missbach, als wir ihn im Klybeck-Forschungsgebäude 136, wo er jahrelang gearbeitet hat, zum Interview treffen. «Für mich war das Zusammenspiel zwischen Chemie, die als einzige Disziplin neue Moleküle aus kleinen Bausteinen herstellen kann, und Biologie, die mit dem lebendigen Material forscht, stets faszinierend.»
Missbach wollte besonders aber eins: an der Entwicklung von Medikamenten arbeiten. «Vor allem die Anwendung der Chemie in der Biologie hat mich interessiert, ein interdisziplinäres Gebiet, das an der Universität noch nicht so etabliert war wie heute. So war für mich die Industrie, wo man das im Labor Hergestellte im biologischen System prüft und daraus vielleicht sogar ein Medikament herstellt, die treibende Kraft.»
Früher Ausbau der Forschung
Die Forschung im Klybeck konnte sich sehen lassen. Schon in den 1880er-Jahren baute die Vorgängergesellschaft Bindschedler & Busch hier als erstes Schweizer Unternehmen eine chemische Forschungsabteilung auf, die sich zunächst auf Farbstoffe und später, nach Gründung der Ciba, auch auf Arzneimittel konzentrierte, zunächst auf die Extraktion von Naturstoffen, dann auf deren künstliche Herstellung.
Der Aufbau einer eigenen chemischen Forschungsabteilung geschah vor allem auf Anregung von Firmengründer Robert Bindschedler, der selbst Chemiker war. Zudem holte er mit Alfred Kern und Robert Gnehm, die am Polytechnikum in Zürich studiert hatten, zwei ausgewiesene Spezialisten ins Unternehmen, die den Forschungs- und Werkplatz Basel nachhaltig prägten und die enge Verzahnung zwischen Hochschule und Industrie förderten.
Rund drei Jahrzehnte später wurde dann auch eine biologisch-pharmakologische Forschungsabteilung gegründet. Zwar blieben deren Ausmasse zunächst bescheiden, doch bildete die Start-up-ähnliche Abteilung die interdisziplinäre Keimzelle, die zu wichtigen medizinischen Meilensteinen beitrug und Missbach und viele andere Forscher später zur Ciba-Geigy führen sollte.
Einer der ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter der neuen Einheit, R. L. Baumgartner, erinnerte sich in einem Artikel der Ciba-Blätter aus dem Jahr 1948 an die frühe Zeit: «Am 1. Oktober 1908 trat der erste Mitarbeiter, Dr. Berthold Schreiber, in die auf Initiative von Direktor Dr. Jacob Schmid damals gegründete biologisch-pharmakologische Abteilung ein. Im ersten Stock des Lokals 27 waren drei kleine Räume für diese neue Abteilung hergerichtet worden.»
Die technische Einrichtung war spärlich, so Baumgartner. «Ein Zimmermann’sches Uhrwerk-Kymographion mit Tintenschreibung, eine improvisierte Apparatur für isolierte Organe, bestehend aus einem Dreifussgestell, einem Emailbecken, einem Darmgefäss und einem Suspensionshebel, sowie einige Kaninchen- und Rattenkäfige bildeten zusammen mit einigen Mäusegläsern das wichtigste Inventar.»